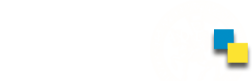Die jüngsten Ergebnisse der repräsentativen Verkehrsbefragung „Mobilität in Städten – SrV 2023” der TU Dresden bestätigen es: Die Schwerinerinnen und Schweriner setzen im Alltag immer häufiger auf nachhaltige Verkehrsmittel und kurze Wege. Nachdem im Januar bereits ein erster Überblick über die Ergebnisse der Studie veröffentlicht wurde, hat die Schweriner Verkehrsplanung nun weitere Details zur nachhaltigen Mobilität in der Landeshauptstadt vorgestellt. Die Befragungsergebnisse der Verkehrswissenschaftler zeigen: Die Mobilität in Schwerin wird umweltfreundlicher und vielseitiger. Sie richtet sich außerdem stärker an den Bedürfnissen der Menschen aus, was die Lebensqualität und Nachhaltigkeit im Alltag weiter steigert.
Autonutzung auf historischen Tiefstand
Bei der prozentualen Verteilung der zurückgelegten Wege auf unterschiedliche Verkehrsmittel (Modal Split) in der Landeshauptstadt dominiert der „Umweltverbund“, zu dem Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV gehören.
Mit rund 34 % liegt der Fußverkehr an der Spitze. Mit dem Fahrrad legen die Bürgerinnen und Bürger circa 15 % und mit dem ÖPNV rund 13 % ihrer Alltagswege zurück. Trotz einer weiterhin signifikanten Autonutzung von 37 % ist der Pkw-Anteil gegenüber 2018 um 5 Prozentpunkte gesunken und liegt damit auf einem historischen Tiefstand. Letztmalig vor 29 Jahren, im Jahr 1994, war der Pkw-Anteil noch niedriger. (vgl. Grafik 1)

Mit einem Anteil von knapp 63 % an den zurückgelegten Wegen sind die Verkehrsträger des Umweltverbunds deutlich attraktiver als die Nutzung eines Autos. Zudem besitzen ein Drittel der Haushalte gar keinen Pkw mehr. Die Zahlen unterstreichen den klaren Trend der Bevölkerung zu nachhaltigen Mobilitätsformen. Bemerkenswert ist dabei die gemittelte Wegelänge von nur 5,1 Kilometern. Dies ist ein ideales Umfeld für nachhaltige, emissionsarme Mobilitätsformen.
Nahverkehrsnutzung überdurchschnittlich
Mit rund 17,6 Millionen Fahrgästen im Jahr 2023 erreichte der Schweriner Nahverkehr einen neuen Höchststand – so viele Menschen nutzten Busse und Bahnen zuletzt vor 15 Jahren. Dieser Wert scheint nachhaltig zu sein, wie die Zahlen des Jahres 2024 zeigen: Insgesamt 17,5 Millionen Fahrgäste.

Damit liegt die Nachfrage nicht nur wieder über den Jahren der Corona-Pandemie, sondern sogar stabil über dem langjährigen Durchschnitt. Der seit den 90er Jahren zu beobachtende Abwärtstrend des ÖPNV-Anteils - damals lag dieser noch bei 25 % - ist zwar noch vorhanden, aber der Rückgang ist deutlich geringer als in den Jahren zuvor (‑0,5 %). Das zeigt: Der ÖPNV in Schwerin erlebt aktuell eine außergewöhnlich hohe Akzeptanz und wird so stark genutzt wie seit Langem nicht mehr.
Das seit Mai 2023 verfügbare Deutschlandticket erfreut sich wachsender Beliebtheit. Allgemein besitzen mehr als ein Viertel (28 %) aller Haushalte eine Zeitkarte für den ÖPNV, was einem Plus von 7 % gegenüber 2018 entspricht. (vgl. Grafik 2)

Auch die Barrierefreiheit gewinnt zunehmend an Bedeutung. Laut aktueller Befragung leben rund 13 % der Schweriner Bevölkerung mit einer dauerhaften Geh- oder Seheinschränkung. Die Stadt investiert daher laufend in den barrierefreien Ausbau der Gehwege, beispielsweise an Querungsstellen und Bushaltestellen.
Viele fahren täglich mit dem Rad
Rund 27 Prozent der Schwerinerinnen und Schweriner nutzen täglich das Fahrrad für ihre Alltagswege, insgesamt steigen 58 Prozent mindestens einmal pro Woche auf das Rad. Diese hohe Nutzungsrate unterstreicht die zentrale Rolle des Fahrrads im städtischen Mobilitätsmix und zeigt, dass die fahrradfreundlichen Strukturen der Stadt immer mehr Menschen erreichen.

Fußgänger besonders zufrieden mit der Verkehrsinfrastruktur
Die Zufriedenheit mit der Verkehrsinfrastruktur ist insgesamt hoch: Am besten bewertet werden die Fußwege (79 %), gefolgt vom ÖPNV (58 %). Die Zufriedenheit mit der Verkehrssituation für das Auto ist bei rund der Hälfte der Befragten hoch. Die Fahrradinfrastruktur hingegen wird nur von einem Drittel (34 %) als überwiegend positiv bewertet.

Warum sind gerade Radfahrer unzufrieden?
Radfahrende bewerten grundsätzlich stärker nach Sicherheits- und Komfortkriterien. Radwege sind oft zu schmal, lückenhaft, schlecht instandgehalten oder durch parkende Fahrzeuge blockiert. Da Radfahrende die dabei auftretenden Sicherheitsprobleme - wie enges Überholen durch Autos oder Konfliktpunkte an Straßenkreuzungen - unmittelbar erleben, fallen Missstände deutlicher auf und die Bewertung fällt meist schlechter aus. Aus diesem Grund arbeitet die Stadtverwaltung intensiv an der Verbesserung der Radinfrastruktur: Zentrale Aspekte sind dabei der Bau abgetrennter Radwege mit ausreichender Breite und die Steigerung des Sicherheitsgefühls. Nach der Eröffnung der ersten Fahrradstraße im Jahr 2024 (Gadebuscher Straße) liegt der Schwerpunkt nun auf der Verbesserung wichtiger Radachsen, beispielsweise zwischen Neumühle und dem Obotritenring.