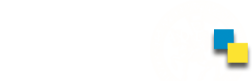Die Bedeutung des Roggens fand im Volksmund einen besonderen Niederschlag. Das hatte durchaus praktische Gründe, denn Anbau und Verarbeitung wurden während der Arbeitsprozesse an die nächste Generation überliefert.
In der Fruchtfolge der landestypischen Dreifelderwirtschaft gab es hinsichtlich der Aussaat des Roggens eigene Bezeichnungen.
Brakroggen nannte man den Roggen, der auf einer gedüngten Brache angebaut wurde.
Stoppelroggen wurde im Anschluss an andere Kornarten, wie Gerste, Hafer oder Buchweizen ausgesät.
Nahroggen war die Bezeichnung für den Roggen, der zweimal hintereinander bestellt wurde. Dies war jedoch selten der Fall.
Aus heutiger Sicht war de leew` Rogg (der liebe Roggen) in der Dreifelderwirtschaft nicht sehr einträglich. Gewöhnlich belief sich der Ertrag auf dat drüdd Kuurn (das dritte Korn). Sehr selten kam an auf das Sechsfache der Aussaat. Erst mit der Einführung der Koppelwirtschaft, ab Mitte des 19. Jahrhunderts, stiegen die Erträge .
Folgende Roggen-Sorten waren in Mecklenburg verbreitet:
„Petkufer“,
„norddeutscher Campagner“,
„Zeeländer“,
„Schanstedter“,
„Altpaleschker“
(siehe: Lesebuch für ländliche Fortbildungsschulen sowie für landwirtschaftliche Winter- und Ackerbauschulen, Lzg. 1909; S. 258)
Der Roggenwert
Da Roggen in Deutschland als das wichtigste landwirtschaftliche Produkt galt, diente der Roggenpreis als Richtwert für die allgemeine Preisgestaltung bzw. Wertbestimmung aller anderen landwirtschaftlichen Produkte. Selbst menschliche und tierische Arbeitsleistungen, Futtermittel, Stalldünger, Grundstückserträge wurden nach Roggenwert taxiert. Mit der Verdrängung der Natural- durch die Geldwirtschaft verschwand diese Berechnungsform.
Zur Ermittlung der Kornpreise: „Zu genauen Bestimmung der jährlichen Roggenpreise sind in Schwerin, Wismar, Rostock, Boizenburg, Grabow beeidigte Kornmakler angewiesen, jene alljährlich 8 Tage vor dem Antoni-Termine gewissenhaft zu notiren und die Zeugnisse bei der Kammer einzureichen, von der sie dann im Regierungsblatte publiciert und demnächst bei Regulirung des Kanon derjenigen Erbpächter, für welche die Kornmärkte dieser Städte normiren, zu Grunde gelegt.“
(Quelle: C.W.A. Balck: Domaniale Verhältnisse in Mecklenburg-Schwerin (1. Bd.) 1864; S.154)
Niederdeutsche Überlieferungen zum Roggen
Wat is dat Best bie de Landwirtschaft? – Dat up de krumm Fohr ok Roggen wasst.
(Was ist das Beste bei der Landwirtschaft? – Das in der krummen Furche auch Roggen wächst.)
Dor löppen Schinner un Racker oewer´n groten Roggen-Acker.
(Da laufen Schinder und Racker – Symbole für viel Arbeit – über´n großen Roggenacker.)