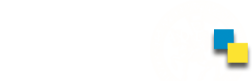Für Schwarzbrot verarbeitete man Roggenschrot bereits am Vorabend mit warmem Wasser, etwas Salz und dem vom letzten Backen aufgehobenen Sauerteig zu einem dicken Brei. Mit Mehl bestreut und gut zugedeckt, konnte der Teig gut gehen (gären). Am nächsten Tag knetete man so viel Schrot in den Teig, bis der formbar wurde und nicht mehr an den Händen kleben blieb. Dann hat man den Teig mit Wasser glattgestrichen, drei Kreuze eingedrückt, mit Mehl überstreut und mit einem „Deiglaken“ (Teiglaken) abgedeckt. An den drei Kreuzen, die das Brot segneten, konnte man auch erkennen, ob der Teigansatz gut war. Dick genug, dann floss das Zeichen ganz allmählich zusammen, ging dies zu schnell, musste man etwas Mehl nachrühren.
Mit `t leiw Brot möt ´n nich asen, dat möt´n denn hüt oder morgen erhungern.“
(Mit dem lieben Brot sollte man nicht aasen, das muss man sich sonst erhungern.)
„Liggen Geld und snäden Brot ist licht vergräpen.“
(Offen liegendes Geld und geschnittenes Brot sind leicht vergriffen.“
„Du hest din Brot ok de längst Tit in min Supp stippt.“
(Du hast Dein Brot auch die längste Zeit in meine Suppe gestippt. Eine Drohung an faule Dienstboten.)
Nach dem Volksglauben durfte man das Brot nicht auf den Rücken legen, denn „up ´n Rüggen kann keener Brot verdeinen.“ (denn auf dem Rücken kann niemand Brot verdienen.
An der Art, wie unverheiratete Frauen das Brot formten, wurde ihnen vorausgesagt: Wer dat Brot mit Bosten makt, kicht enen rugen Mann, wer den Teig glatt makt, kricht enen schiren. (Wer das Brot mit unebener Kruste macht, bekommt einen rauhen Mann, wer den Teig glatt macht, einen reinen. )
Segensspruch für das Brot:
dat Brot is in 'n Aben, De Herrgott sägen 't von unnen un von baben, Dat all', dee dorvon äten, Den Herrgott nich vergäten
(das Brot ist im Backofen, der Herrgott segnet es von unten und von oben, auf dass alle, die davon essen, den Herrgott nicht vergessen)