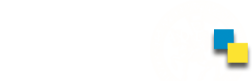Aust oder Oorn war der geläufige Begriff für die Ernte in Mecklenburg. Erntearbeiter gaben an, ik gah up de Oorn (ich gehe in die Ernte).
Der Flurzwang erforderte für alle einen gemeinsamen Erntebeginn. Der Termin wurde beim herzoglichen Amt angefragt oder vom Dörpschult (Dorfschulzen) ermittelt. Es gab verschiedene Rituale, um den Reifegrad des Roggens zu ermitteln. Einige bissen auf ein Roggenkorn, knackte dieses, durfte angemäht werden. Andere schlugen mit einem Hut gegen die Kornhalme. Fielen 11 Körner hinein, war der Roggen angeblich reif.
Auf dem Riddergau (ritterschaftliches Gut) entschied allein der Gautsherr (Gutsherr), wann die Ernte beginnen sollte.
„§ 137… Der Verlust ist allemal zu beträchtlich, wenn das Getreide zu reif wird. Der größte Theil der mecklenburgischen Wirthe erkennt daher auch die Wahrheit des alten Sprichworts: Oraculum esto, biduo citius quam biduo ferius metere. (Lieber zwei Tage zu früh als zwei Tage zu spät mit der Ernte beginnen.)
Aus: Franz Christian Lorenz Karsten, herzogl Professor der Oekonimie zu Rostock: Die ersten Gründe der Landwirtschaft, sofern sie in Deutschland, und vorzüglich in Meklenburg, anwendbar sind, Rostock/ Berlin 1795
Erntebeginn wurde stets groß gefeiert. Der Schulze ließ dazu die Glocken läuten oder blies ins Schulzenhorn. Es galt, ihrer Strikelbier wäst is, hett keen Knecht de Seiß anfat't (bevor es kein Streichbier gab, hat kein Knecht die Sense angefasst. Gemeint war das Streichen/ Schärfen der Sense).
Sprach man von horen, meinte man das Schärfen, wie de hohrt sick de Seiß up den Süll (der schärft seine Sense auf der Schwelle).
Gutes Dengeln musste gelernt sein und wurde entsprechend gelobt: dee is œwer gaut hoort, de Snid' löppt vör 'n Dumennagel (der ist aber gut hart, die Schneide läuft vor dem Daumennagel).
Es mussten verschiedene Gebote eingehalten werden. So durfte mittags nicht angemäht werden, dann würden die Pferde abmagern.
Es war verpönt, eine Arbeit, die eine längere Zeit in Anspruch nimmt, an einem Montag zu beginnen. So wurde montags etwa nicht gesät, nicht angemäht, das Vieh nicht ausgetrieben oder zum Decken gebracht.
Wat up 'n Mandag begunnen ward, ward nich ne Woche olt.
(Was am Montag begonnen wird, wird keine Woche alt).
Das erste Swad (Getreide, das der Mäher mit einem Sensenschnitt abmäht)
hatte der Bauer selbst zu mähen.
Roggenbuck (Roggenbock) war eine volkstümliche Bezeichnung für die Person, die bei der Roggenernte die letzte Garbe gebunden hat.
Wenn de Rogg meiht würd, dat wier binah duller as up ´ne Hochtiet.
(Wenn der Roggen gemäht wird, das war beinahe doller als auf einer Hochzeit)
Wenn in de Aust nich sungen würd, wier de Buerfru nich tofräden.
(Wenn während der Ernte nicht gesungen wurde, war die Bäuerin nicht zufrieden).
Wenn de Aust kümmt, denn is de Hungertied vörbi.
(Wenn die Ernte kommt, dann ist die Hungerzeit vorbei).