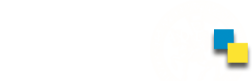Die Verarbeitung des Getreides fand im Mecklenburg in zahlreichen herzoglichen Mühlen statt, zu denen die Mühlensteine u.a. aus Pirna (Sachsen) und Perleberg herbeigeschafft wurden. Der Bau herzoglicher Mühlen gab oft Anlass zu Streitigkeiten mit dem Adel, der auch für sich das Recht beanspruchte, Mühlen zu errichten. Derartige Beschwerden wurden jedoch abgewiesen. Dagegen erließen die Mecklenburgischen Herzöge Müllerordnungen, die Richtlinien zur Beseitigung von Missständen beinhalteten.
Um 1800 gab es in Schwerin die Binnenmühle mit drei Gängen, die Bischofsmühle mit vier Gängen und die zweigängige Bockmühle (auch Neumühle).
Dagegen zählte Rostock damals 6 Wassermühlen, 4 Windmühlen und 1 Grützmühle.
Niederdeutsche Überlieferungen zum Müller und zur Mühle
Oft nah de Mœhl un oft den Aben warm, dat maakt den Buern
(Oft zum Müller und oft einen warmen Ofen, das macht den Bauern arm)
Solang' de Wind weiht Un de Mœhl nich steiht, Den Windmöller dat woll geiht.
(Solange der Wind weht und die Mühle nicht steht, geht es de Windmüller gut.)
Scherzbezeichnung für Müller: de olle Mählsack (der alte Mehlsack) Mattendeew (unehrlicher Müller)
Mattkuurn (Mattenkorn), das war das Korn, dass der Müller behielt, als Teil des Mahllohnes.